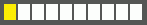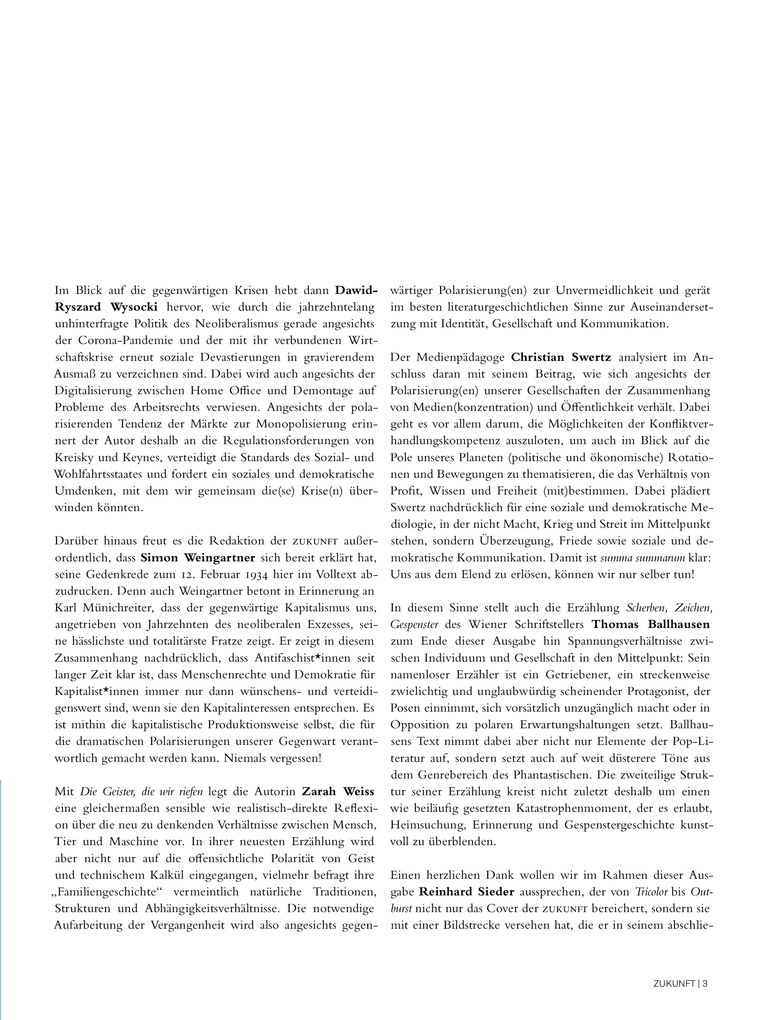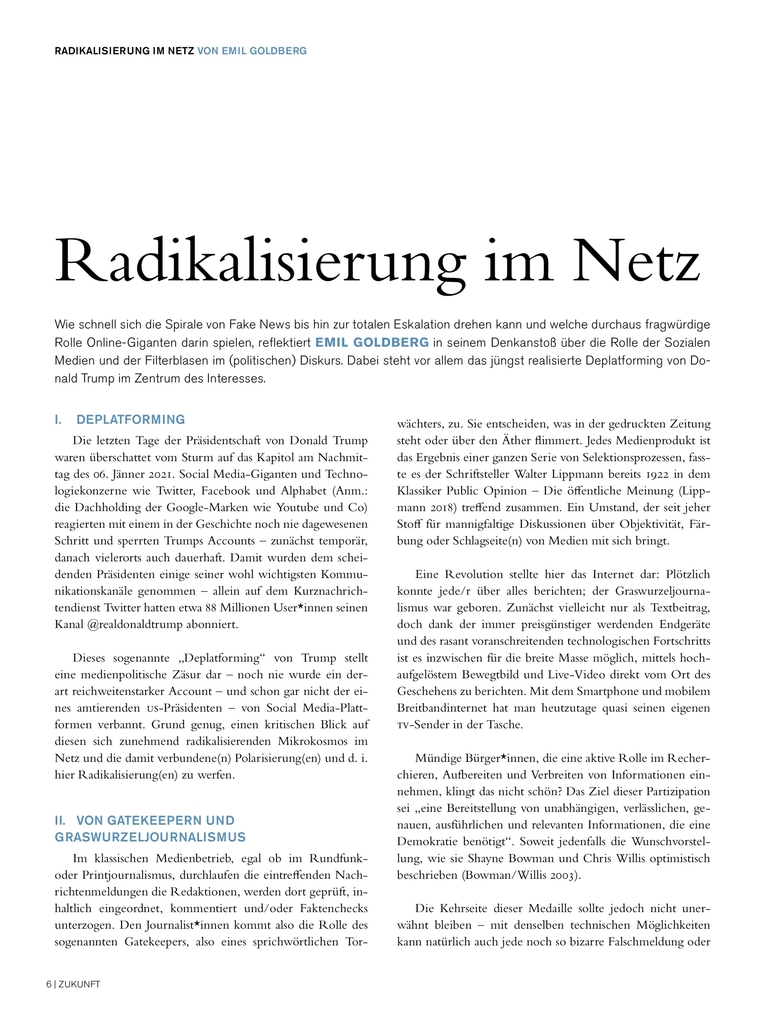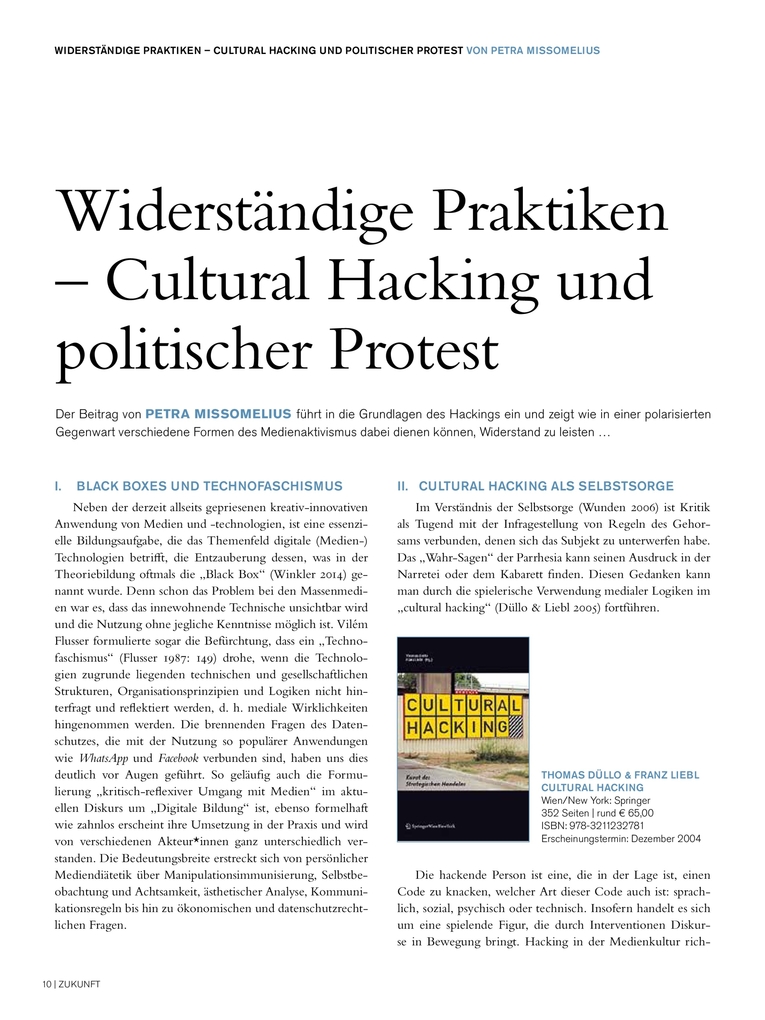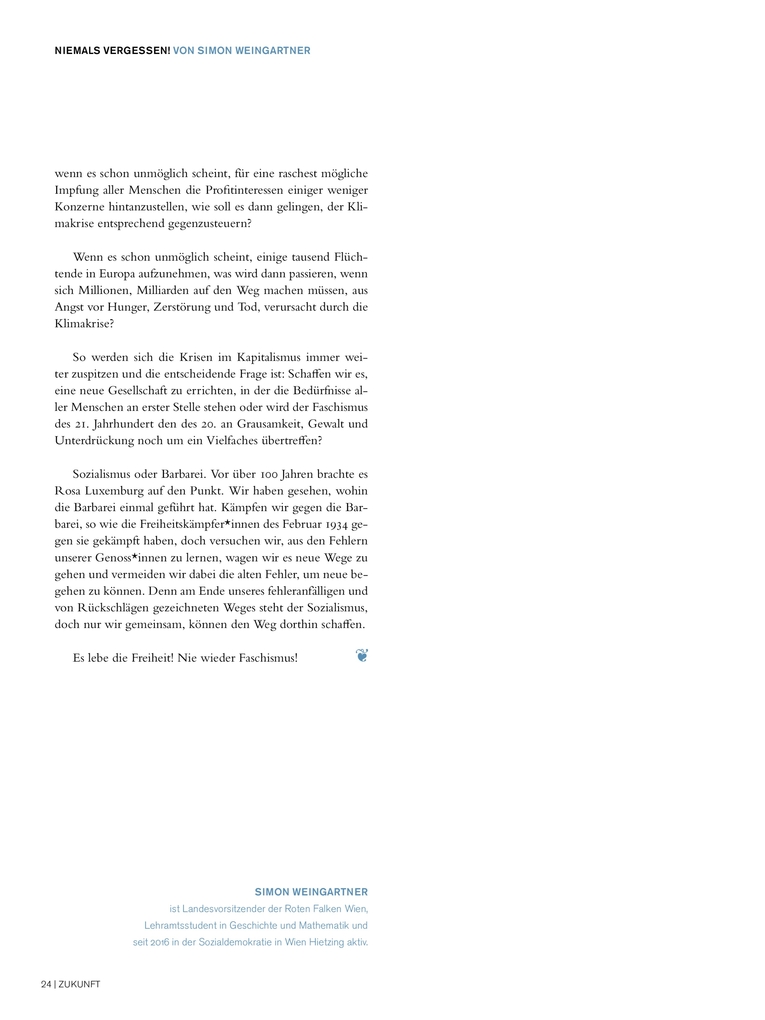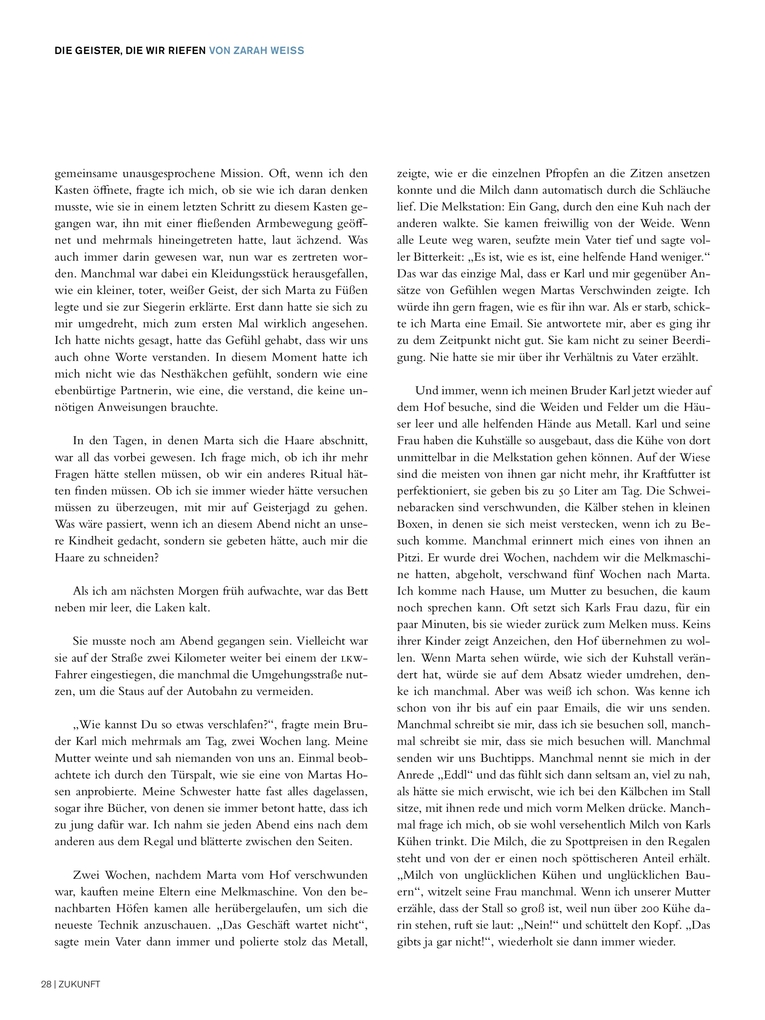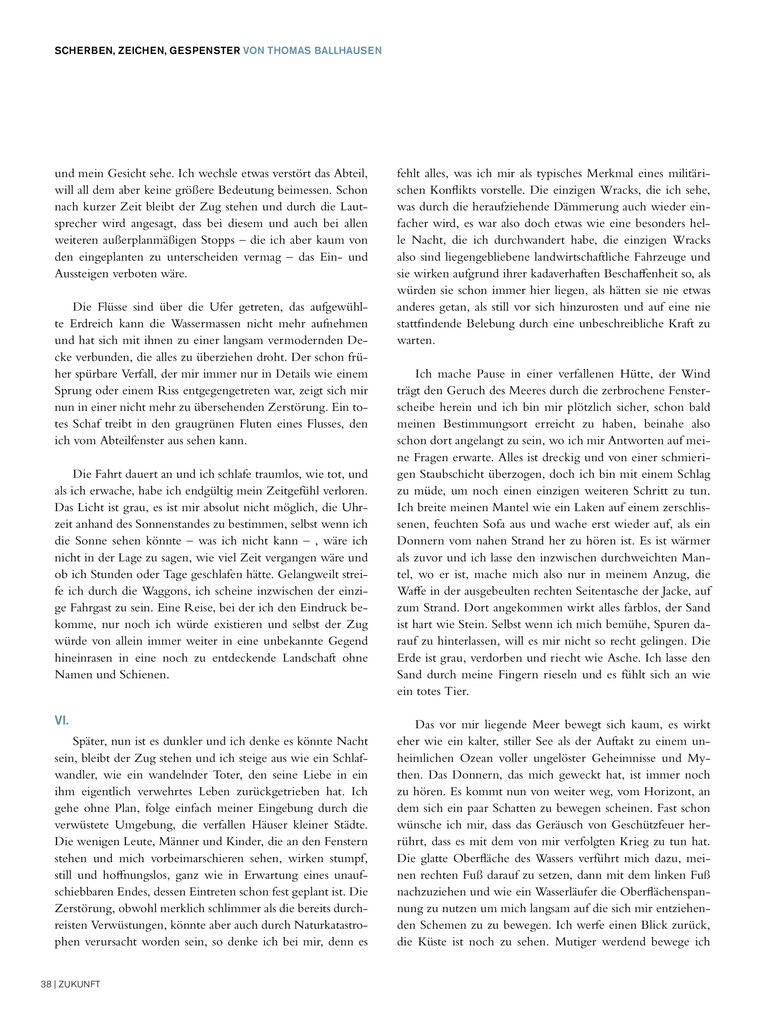ZUKUNFT | 27
tern, überfordert, so standen sie mit staksigen Beinen im Stroh und sahen mich mit großen Augen an, wichen zurück, wenn ich eine zu schnelle Bewegung machte oder versuchte sie zu berühren. Meistens reichte es mir, sie einfach nur anzuschau-en, ihre Flecken zu zählen, ihnen Namen zu geben. Heu-te aber öffnete ich mit einer vorsichtigen Handbewegung das kleine Gatter und suchte mir eine Stelle im Stroh, die nicht vollgepinkelt war. Da saß ich dann, bei meinem Lieblingskalb, das ich Pitzi genannt hatte und das ganz hell war, nur weni-ge schwarze Flecken hatte es. Es starrte mich an, ging ein paar Schritte rückwärts, blieb schließlich stehen. Ich berührte ganz sanft die Flanke, richtete mich auf, legte eine Hand flach auf Pitzis Nase. „Alles wird gut, Pitzi“, sagte ich ganz leise und das Kalb stand still. Ich bildete mir immer ein, dass es mich erkannte, am Geruch, an meiner Stimme. Die Kälber waren noch kleiner als ich. Sie hatten noch weniger Ahnung von der Welt als ich. Wenn ich bei ihnen war, dann war ich diejenige, die sie beruhigen konnte, die ihnen Dinge erklären konnte.
„Alles wird gut“, sagte ich noch einmal, als meine Eltern
mich irgendwann riefen, um ihnen beim Melken zu helfen und dann kletterte ich über das Gatter und lief zum Kuhstall, ohne mich noch einmal umzudrehen, weil ich doch wusste, dass nichts gut werden würde. Marta würde irgendwann ge-hen und sie würde nicht wieder zurückkommen auf diesen Hof und Pitzi würde bald abtransportiert werden zur Schlach-tung wie all die anderen jungen Stiere, zu denen ich eine kur-ze Beziehung aufgebaut hatte und die dann verschwanden und das war genauso normal, wie dass ich andere aufwachsen sah und sie in den Melkstall lotste, wo Mutter oder Vater dann auf ihren Plastikschemeln saßen.
Martas Verhalten schien keine weiteren Konsequenzen zu
haben. Nur das Abendbrot verlief stiller als sonst, als wür-den wir uns alle nicht trauen, etwas zu sagen. Sie verschwand nach dem Essen schnell in unserem Zimmer und als ich die letzten Aufgaben am Küchentisch gerechnet hatte, nach oben ging und die Tür öffnete, hatte sie das Licht schon ausge-schaltet, lag im Bett und tat so, als würde sie schlafen. Ich sag-te ihren Namen, ihr Atmen blieb konstant. Als ich mich ins Bett legte, zog ich die Decke bis zu meiner Nasenspitze und stellte mir vor, wie ich wohl von oben aussah, mit meinen schmalen Augen, die ich versuchte, weit offen zu halten und an die Decke zu starren und mit meinen hellen, fast gelben Haaren. „Hallo“, sagte ich leise zu der imaginären Person, die mich dort aus der Vogelperspektive betrachtete. Marta bewegte sich: „Edda, jetzt sei mal leise, ich will schlafen!“
Sie drehte sich mit dem Rücken zu mir. „Ok“, sagte ich und zeichnete die Umrisse der Möbel mit meinem Kopf nach, den Tisch, die zwei Stühle, den großen Kasten. Als Kind hat-te Marta immer wieder hineingetreten, aus Angst vor Geis-tern oder Monstern. Sie hatte mich dann nie als Erste ins Zimmer gehen lassen, um mich zu beschützen und weil ich die Monster sowieso nicht richtig vertrieben hätte. Also hat-te ich immer hinter ihr gewartet, sie dabei beobachtet, wie sie ein paar Sekunden vor der Zimmertür verharrt und sich in die kämpferische Stimmung gebracht hatte. Sie war sechs Jahre älter als ich und ich hatte sie immer beobachtet, meine Hände im Saum meines Kleids verkrampft. Nach dieser kur-zen Rückbesinnung hatte Marta tief Luft geholt, die Klinke heruntergedrückt und die Tür mit einem solchen Schwung geöffnet, dass sie knallend gegen die Wand geschlagen war. Was immer sich dahinter versteckt hatte: Es war auf jeden Fall platt und mausetot. Danach hatte Marta kurz dort gestanden, wie um diesem Knall zu lauschen, schließlich war sie mit ei-nem Schritt hineingetreten. Ich war dann immer hinterher-geschlichen, meine Aufgabe war es gewesen, das Licht hin-ter ihr anzumachen, dazu hatte sie keine Zeit gehabt in ihrer schwierigen Mission. Ich war ihre Gehilfin gewesen, hatte die Drecksarbeit für sie erledigt, so wie sie es manchmal genannt hatte. Das bedeutete: in ihrem Schatten stehen, das Licht für sie anmachen, so zu tun, als sei ich nicht da, um die Geister nicht vorzuwarnen. Ich hatte dann immer an der Wand ge-lehnt, Marta beobachtet. Wie sie eine Sekunde im Raum ge-standen hatte, bis sich ihre Augen wieder an das plötzliche Licht gewöhnt hatten. Meine einzige Aufgabe war es gewe-sen, im Schatten zu stehen, also hatte ich nie etwas gesagt. Dann hatte sie einen Entschluss gefasst, es war immer dersel-be gewesen, immer war sie zuerst zum Bett gegangen. Mit stampfenden Schritten, mehrmals darunter getreten. „HA!“, hatte sie gerufen. Wäre ich ein Geist gewesen, hätte ich mich schon von ihrem Schrei in Luft aufgelöst, aber ich war nur ihre kleine Schwester und hatte bloß den dummen Gedanken gehabt, ob Geister sich in Luft auflösen konnten, wenn sie doch eigentlich aus Luft bestanden. Einmal hatte ich diesen Gedanken laut ausgesprochen, Marta hatte sich ruckartig zu mir umgedreht. „Als ob es hier nur um Geister geht, Edda“, hatte sie laut und zischend gesagt. Das war der letzte Abend gewesen, an dem sie dieses Ritual vollzogen hatte. Jedes Mal danach hatte sie sich zwar noch misstrauisch im Zimmer um-gesehen, aber immer wieder selbst das Licht eingeschaltet und so getan, als sei sie eine normale Erdenbürgerin, die nur das glaubte, was sie vor sich sah. Mit dieser Nacht war etwas zwischen uns getreten, wir hatten ein Band verloren, unsere